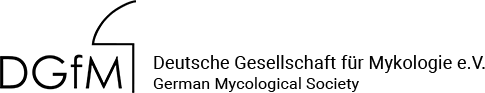Pilz des Jahres
Menü
Pilz des Jahres
Erfahren Sie, weshalb die Deutsche Gesellschaft für Mykologie 1994 den „Pilz des Jahres“ begründete und welche Arten seither auserkoren wurden, um Pilze als elementare Lebewesen unserer Ökosysteme zu beleuchten.

Seit 1994 wählt die Deutsche Gesellschaft für Mykologie alljährlich den „Pilz des Jahres“. Die präsentierte Art soll stellvertretend für alle Pilze den Blick der Öffentlichkeit auf die wichtige Bedeutung der Pilze für unser Ökosystem richten.

Igelstachelbart
Hericium erinaceus (Bull.) Pers.
Der Igelstachelbart, auch bekannt unter Namen wie Yamabushitake, Löwenmähne, Pom-Pom blanc oder Affenkopfpilz, kommt vor allem in Laubwäldern mit hoher Luftfeuchtigkeit vor. Er wächst als holzzersetzender Weißfäulepilz an frischem Totholz, meist an Buchen oder Eichen. Obwohl er ein beliebter Speisepilz ist, sollten die Wildbestände aus Naturschutzgründen geschont werden. Als Kultur- und Heilpilz gewinnt er jedoch zunehmend an Bedeutung und Bekanntheit.

Amethystfarbene Wiesenkoralle
Clavaria zollingeri Lév. (1846)
Die Amethystfarbene Wiesenkoralle (Clavaria zollingeri) ist ein mittelgroßer, korallenartig ästig wachsender, freudig lila-violett gefärbter Pilz. Er wächst in Europa in extensiv genutzten Wiesen, Eschenwäldern und Schlehengebüschen in Gesellschaft mit Erdzungen, Rötlingen, Saftlingen und Wiesenkeulchen. Seine weite Verbreitung auf allen Kontinenten lässt vermuten, dass es sich um ein sogenanntes Urzeitrelikt handeln könnte.

Schopf-Tintling, Spargelpilz
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 1797
Der leicht kenntliche Schopf-Tintling ist jung ein ausgezeichneter Speisepilz. Sein weißer, walzenförmiger Hut ist mit abstehenden Schuppen besetzt. Die ähnlichen, häufigen Specht- und Faltentintlinge haben jung kein rein weißes Hutfleisch. Seltenere Doppelgänger wachsen auf Dung oder Mist, oder riechen nach Maggi. Hut und Lamellen des Schopf-Tintlings verfärben sich bald rosa, dann schwarz und tropfen als dunkle Masse herab.

Sumpf-Haubenpilz
Mitrula paludosa Fr. 1816
Der Sumpf-Haubenpilz (Mitrula paludosa) ist ein kleiner Schlauchpilz (Ascomycet), der in sauberen Gewässern gefunden werden kann. Er gehört zur formenreichen Gruppe der erdzungenartigen Pilze und zeichnet sich besonders durch seine ökologische Spezialisierung aus. Seine Lebensräume sind pfützenreiche Sümpfe und sumpfige Stellen schwach fließender Bäche und Quellgebiete.

Fliegenpilz, Roter Fliegenpilz
Amanita muscaria (L.) Lam. 1783
Der nahezu weltweit verbreite Fliegenpilz (Amanita muscaria) zählt zu den häufigsten Pilzarten Deutschlands. Er gilt als Glückssymbol, ist Gegenstand zahlreicher Mythen und kultiger Handlungen und der bekannteste Giftpilz schlechthin, den selbst kleine Kinder erkennen. Durch seine auffällige Gestalt, Größe und Farbe ist ihm ein Platz unter den schönsten Pilzen unseres Planeten sicher.

Grünling, Echter Ritterling
Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. 1871
Der Grünling oder Echte Ritterling (Tricholoma equestre) gilt als Charakterart sandiger Kiefernwälder. Als ergiebiger, schmackhafter Speisepilz wurde er früher auf Märkten gehandelt. Heute gilt er als Giftpilz, weil er nach dem Verzehr mehrere Todesfälle verursachte. Inzwischen sind die Bestände in vielen Teilen Deutschlands rückläufig, sodass sich der Grünling als Marktpilz kaum noch lohnen würde.

Gewöhnliche Stinkmorchel, Leichenfinger
Phallus impudicus Linnaeus 1753
Die Gewöhnliche Stinkmorchel (Phallus impudicus) wächst aus einem eiförmigen bis kugeligen Hexenei. Bei Reife beginnt sie nach Aas zu stinken, was u. a. Insekten anlockt. Die zuckerhaltige Sporenmasse an der Spitze verflüssigt sich und wird vor allem von Fliegen verspeist. Raffiniert: Die kleinen Tiere verteilen die Sporen des Pilzes durch ihre Ausscheidungen in der Umgebung.

Grüner Knollenblätterpilz, Grüner Gift-Wulstling
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr. 1821) Link 1833
Die meisten tödlichen Pilzvergiftungen in Mitteleuropa gehen auf den Grünen Knollenblätterpilz zurück. Schon der Verzehr von 50 Gramm eines Pilzfruchtkörpers kann tödlich enden. Denn die darin enthaltenen lebergiftigen Amatoxine verursachen ohne medizinische Versorgung ein mehrfaches Organversagen.

Wiesen-Champignon, Feld-Egerling
Agaricus campestris L. 1753
Mit dem Wiesen-Champignon stellt die Deutsche Gesellschaft für Mykologie den wild wachsenden Verwandten des Zucht-Champignons als „Pilz des Jahres 2018“ vor. Der weit verbreitete Wiesen-Pilz verliert leider durch die intensive Grünlandnutzung mit immensen Stickstoffüberschüssen in Deutschland viele seiner Lebensräume.

Judasohr, Holunderpilz
Auricularia auricula-judae (Bull.) Wettst. 1886
Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie hat das Judasohr zum „Pilz des Jahres 2017“ gewählt. Der Speisepilz hat die Form einer Ohrmuschel und ist auch für unerfahrene Pilzsammler leicht zu bestimmen. Da der Fruchtkörper mehrfach komplett austrocknen und wieder aufquellen kann, regt das Judasohr dazu an, sich mit der Ökologie der Pilze zu beschäftigen.

Lilastiel-Rötelritterling, Masken-Rötelritterling
Lepista personata (Fr.) Cooke 1871
Mit dem Lilastiel-Rötelritterling stellt die Deutsche Gesellschaft für Mykologie einen „Pilz des Jahres“ vor, für dessen Erhalt Deutschland eine besondere Verantwortung trägt. Der attraktive Pilz kommt verbreitet vor, hat aber durch die fortschreitende Grünlandintensivierung schon viele seiner Lebensräume verloren.

Becherkoralle, Kandelaberkoralle
Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich 1982
Licht und Schatten der Klimapolitik: Die zunehmende Nutzung von abgestorbenem Holz aus den Wäldern zum Heizen schont die Vorräte an fossilen Brennstoffen, aber sie reduziert den natürlichen Lebensraum für viele wichtige und auch seltene Organismen. Um auf dieses Dilemma hinzuweisen, hat die Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM) die Becherkoralle zum „Pilz des Jahres 2015“ gewählt.

Tiegelteuerling
Crucibulum laeve (Huds.) Kambly 1936
Die DGfM möchte mit der Wahl des Tiegelteuerlings zum „Pilz des Jahres 2014“ auf die große Bedeutung der Pilze in den natürlichen Stoffkreisläufen aufmerksam machen. Es sind in erster Linie die oft im Verborgenen wirkenden Fadenwesen, die mit ihren Enzymen abgestorbene, organische Stoffe wie Holz, Blätter oder Nadeln remineralisieren und somit wieder für die Pflanzenwelt verfügbar machen. Ohne diese Ökosystemleistung der Pilze würde in kürzester Zeit die gesamte Nahrungskette zusammenbrechen.

Braungrüner Zärtling, Braungrüner Rötling
Entoloma incanum (Fr.) Hesler 1967
Der Braungrüne Zärtling kann in vielen Bereichen Deutschlands, Europas und darüber hinaus entdeckt werden. Neben seinen prächtigen Farben hat er auch einen sehr markanten Geruch nach verbranntem Horn oder Mäusekot, den seine Finder noch lange im Gedächtnis behalten. Als Lebensräume sind basenreiche, aber stickstoffarme Magerwiesen bekannt, die in unserer durch intensive Landwirtschaft überdüngten Landschaft leider stark beeinträchtigt sind. Der EU-geförderte Energiepflanzenanbau gefährdet auf diese Weise noch die letzten Lebensräume von Tausenden Pflanzen-, Pilz- und Tierarten.

Grauer Leistling, Graue Kraterelle
Cantharellus cinereus (Pers.) Fr. 1821
Ein unscheinbarer Geselle ist der Graue Leistling. Mit seinen graubraunen Tarnfarben ist er schwer im Herbstlaub auszumachen. Es sei denn, er wächst zwischen gelb verfärbten Hainbuchenblättern, wie auf unserem wunderschönen Bild des Pilzfotografen und Hobby-Mykologen Marco Gebert. Mit seinem trichterförmigen Hut, den grauen Leisten auf der Hutunterseite und dem braunen Stiel ähnelt er dem Trompeten-Pfifferling. Der Fachmann erkennt schon anhand des lateinischen Namens „Cantharellus cinereus“, dass der Graue Leistling tatsächlich mit dem Pfifferling verwandt ist.

Roter Gitterling
Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. 1801
Mit seinem geradezu außerirdischen Aussehen gehört der Rote Gitterling zu denjenigen Pilzen, die nicht zu übersehen sind. Seine fleischrote Gitterkugel schiebt sich etwa Tennisball groß aus einer schmutzig eierschalenfarbigen Hülle, dem Hexenei. Der Gitterkugel entströmt nach ihrer Entfaltung ein aasartiger Geruch, der Fliegen anlockt. Diese Kreatur sieht eher aus wie ein Alien aus einem Science-Fiction-Horrorfilm. Ist das überhaupt ein Pilz? Wenn ja, warum sieht er so aus und warum stinkt er so bestialisch? Ist er giftig oder sogar gefährlich? Lockt er die Fliegen an, um sie zu fressen wie eine fleischfressende Pflanze? Die Phantasie projiziert in uns bei der Betrachtung des Roten Gitterlings Angst und Ekel, aber auch Interesse und Bewunderung.

Schleiereule, Eulenauge, Blaugestiefelter Schleimkopf
Cortinarius praestans (Cord.) Gill. 1874
Die Schleiereule ist eine leicht kenntliche Art aus der in Mitteleuropa mit weit über 700 Arten vertretenen Gattung der Schleierlinge. Sie ist in weiten Gebieten Deutschlands recht selten und fehlt in Norddeutschland völlig. Mit über 20 cm Hutbreite ist die Schleiereule nicht nur die größte Art der Gattung; sie ist auch sehr wohlschmeckend und in der Schweiz und in Frankreich ein beliebter Marktpilz. Schwermetallbelastung der Fruchtkörper und die Möglichkeit der Verwechslung mit anderen hochgiftigen Schleierlingsarten lassen die Schleiereule jedoch in einem zweifelhaften Licht erscheinen. Vom Sammeln zu Speisezwecken ist deshalb dringend abzuraten.

Blauer Rindenpilz
Terana caerulea (Lam.) Kuntze 1891
Krustenförmig wachsende Pilze aus der künstlichen Sammelfamilie der Corticiaceae sind nicht jedermanns Sache. Ihre Bestimmung kann in den allermeisten Fällen nur mikroskopisch bewerkstelligt werden. Zudem sind Corticiaceae oft recht unscheinbar und von ihrem Aussehen her unattraktiv. Den Blauen Rindenpilz kann man jedoch schon aufgrund seiner wunderschönen indigofarbenen Fruchtkörper einfach nicht übersehen. Der Altmeister unter den Corticiologen, der Schwede John Eriksson, sagt vom Blauen Rindenpilz: „Es ist die Corticiacee, die am einfachsten zu erkennen ist“.

Bronzeröhrling, Schwarzhütiger Steinpilz
Boletus aereus Bull. 1789
Der Bronzeröhrling, auch Schwarzhütiger Steinpilz genannt, ist ein stattlicher Pilz aus der Verwandtschaft der Steinpilze. Mit ihm soll auf eine seltene und damit in ihrem Bestand gefährdete Pilzart aufmerksam gemacht werden. Der Gewöhnliche Steinpilz (Boletus edulis) ist bei entsprechender Witterung in unseren Wäldern leicht zu finden, und er ist das Objekt der Begierde jedes Pilzsammlers. Einen Bronzeröhrling zu entdecken, ist hingegen eine echte Glückssache. Er gehört zu den schönsten Überraschungen, die ein Pilzfreund auf seinen Streifzügen durch unsere Wälder erleben kann.
Seite 1 von 2
- 1
- 2
© Deutsche Gesellschaft für Mykologie e.V. | Content Management by Joomla!