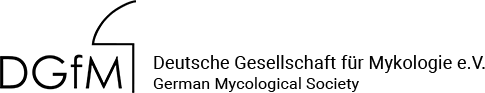News
Menü
News
Unsere News informieren Sie über die faszinierende Welt der Pilze inklusive den Zeitschriften und dem aktiven Vereinsleben unserer Gesellschaft.

- Details
Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat seinen Bericht „Radioaktive Kontamination von Speisepilzen“ mit Messergebnissen erweitert. Auch 2017 wiesen einige wild wachsende Speisepilze deutlich erhöhte Werte des radioaktiven Cäsium-137 auf.

- Details
Gestern feierte Psathyrella cascoides seine zweite Premiere: Der erst heuer neu beschriebene Faserling hat es dank einer Initiative von Robert Schaike (Leopoldshöhe) ins Lokalfernsehen des WDR geschafft!

- Details
Janosch Deeg gibt in seinem Artikel „Unterschätzte Botanik: Die vernetzte Welt der Pflanzen“ auf spektrum.de einen umfassenden Überblick über die Vernetzung von Landpflanzen mittels feiner Pilzfäden im Boden. Manche Forscher vergleichen diese Pilznetzwerke sogar mit neuronalen Netzwerken.
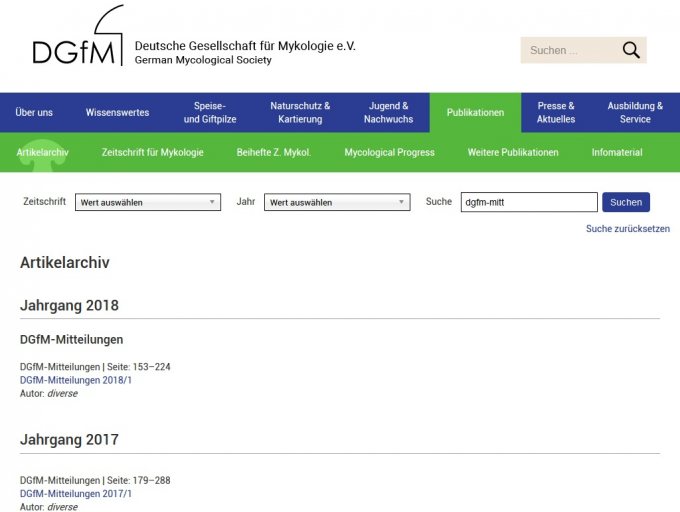
- Details
Im Artikelarchiv können ab sofort die seit 2012 erschienenen DGfM-Mitteilungen heruntergeladen werden. Sie sind kostenlos als Sammel-PDF-Dateien abrufbar.

- Details
Der DGfM-Fachausschuss „Toxikologie und Pilzverwertung“ hat die Liste „Pilze mit uneinheitlich beurteiltem Speisewert“ aktualisiert. Ein Name wurde korrigiert und zwei weitere Arten wurden hinzugefügt.

- Details
Die Qualität von Frischpilzen im Handel ist häufig schlecht, teils ist die empfindliche Ware bereits verdorben. Mit den Verbraucherschutztafeln der DGfM kann jede Kundin und jeder Kunde den Zustand der wichtigsten Marktpilze beurteilen und so ihre bzw. seine Gesundheit schützen.

- Details
Die DGfM ist Partner des mit EU-Drittmitteln kofinanzierten Forschungsprojekts „Funga des Böhmerwalds“.
In der Region Böhmerwald sollen grenzübergreifend Daten zur Verbreitung, Ökologie und Molekulargenetik von Pilzen gesammelt, gemeinschaftlich ausgewertet und öffentlich dargestellt werden.

- Details
Das Bundesamt für Risikobewertung hat seine Broschüre „Risiko Pilze“ ins Arabische übersetzt. Darin informiert das BfR über genießbare, unverträgliche und giftige Pilze. Mit der arabischen Ausgabe richtet sich die Behörde an Geflüchtete, die hiesige Pilzarten nicht kennen.

- Details
Selbst drei Jahrzehnte nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl werden in einigen Pilzarten erhöhte Aktivitäten des Radionuklids Cäsium-137 (Cs-137) gemessen, informiert das Bundesamt für Strahlenschutz.

- Details
Im September 2015 gab es unter syrischen Flüchtlingen zahlreiche Vergiftungen mit dem Grünen Knollenblätterpilz (Amanita phalloides). Einige davon endeten tödlich, in anderen Fällen erfolgte eine Lebertransplantation. In 2016 ereignete sich ein weiterer Fall.
Unterkategorien
© Deutsche Gesellschaft für Mykologie e.V. | Content Management by Joomla!