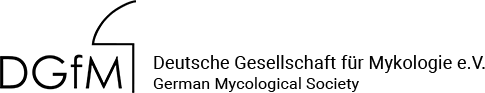News
Menü
News
Unsere News informieren Sie über die faszinierende Welt der Pilze inklusive den Zeitschriften und dem aktiven Vereinsleben unserer Gesellschaft.

- Details
Noch bis zum 24. Januar 2021 findet im Museum für Naturkunde Magdeburg die Sonderausstellung „Pilze – Netzwerker der Natur“ mit Pilzmodellen aus der Werkstatt von Lilo und Klaus Wechsler (Bremen) statt. Die Pilze wirken in ihrer Darstellung absolut echt und sind in verschiedenen Dioramen biotopgerecht in übersichtlichen Vitrinen zusammengestellt.

- Details
La Palma – Insel der Pilze. Den Namen hat die kleine Kanarische Insel verdient mit ihren 1.500 gelisteten Pilzarten. Einen Groβteil davon kann man am 28. November 2020 während des ‘Gran Día de Setas’, dem Groβen Tag der Pilze, im Erholungsgebiet El Pilar sehen. Nach ausgiebiger Suche werden die Funde bestimmt und mit Namen versehen zu einer Ausstellung arrangiert. Die essbaren Pilze werden köstlich zubereitet und an die Besucher gratis ausgegeben.

- Details
Bei unseren Waldbegehungen und Pilzführungen kommen wir in feuchten Waldgebieten und an Bachläufen immer wieder mit Salamandern in Kontakt. Dies birgt die Gefahr, dass eine neuartige und als „Salamanderpest“ bekannt gewordene Pilzkrankheit ungewollt verschleppt wird. Sie wird durch den pathogenen Chytridpilz Batrachochytrium salamandrivorans – kurz „Bsal“ – verursacht und dezimiert vor allem die Bestände des Feuersalamanders.

- Details
Die Diskussion im Forum, Schwefelporlinge könnten aus dem Holz giftiger Bäumen Toxine aufnehmen und beim Verzehr durch Menschen Vergiftungen verursachen, stieß unvermittelt auf Interesse: Frau Dr. Anett Werner, die Leiterin der AG Enzymtechnik am Institut für Naturstofftechnik der Technischen Universität Dresden, bot an, einen Stamm von Eibe oder Robinie in Kultur zu nehmen und zu untersuchen. In ihrem Fokus steht vor allem die Erforschung der Enzyme und Myzelstruktur.

- Details
Am heutigen Internationalen Tag der biologischen Vielfalt ruft die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU) dazu auf, die Funde von Jahreswesen in Rheinland-Pfalz und den benachbarten Gebieten über ihr Bürgerwissenschaftsportal „ArtenFinder Rheinland-Pfalz“ zu melden. Die DGfM unterstützt die Kampagne und bittet um Fundmeldungen der Gewöhnlichen Stinkmorchel, unser Pilz des Jahres 2020.

- Details
Um Pilze stärker bei Umweltgutachten, Forschungsprojekten etc. mit einzubeziehen, sind qualifizierte Fachleute notwendig. Doch aktuell gibt es weder eine Ausbildung noch eine Richtlinie dafür. Die DGfM will mit einer feldmykologischen Qualifizierung in drei Stufen die Artenkenntnis in Deutschland fördern und junge Menschen für die Projektarbeit mit dem Fokus auf Pilze begeistern.
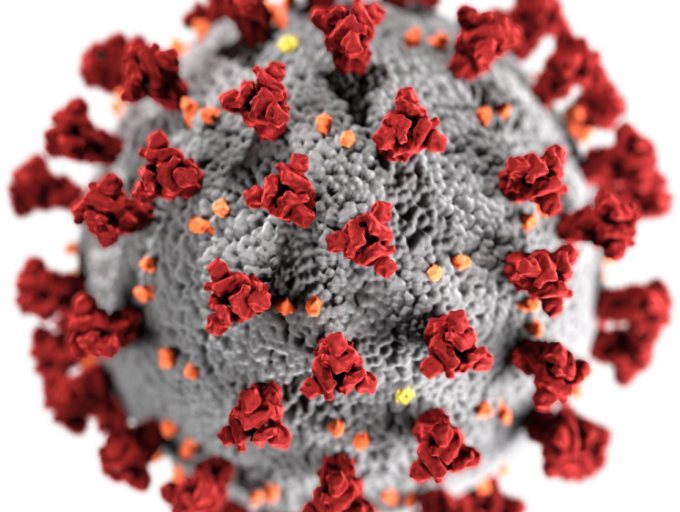
- Details
Aufgrund der Pandemie mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich das Präsidium dazu entschlossen, die vom 30.4. – 3.5.2020 geplante Tagung in Schmitten inklusive der Mitgliederversammlung am 2.5. abzusagen. Die DGfM übernimmt ggf. anfallende Stornogebühren. Leider lässt sich in der Kürze der Zeit keine Ersatzveranstaltung im Herbst realisieren. Für die MV wird jedoch eine Lösung gesucht. Wir bitten um Verständnis in dieser Ausnahmesituation.
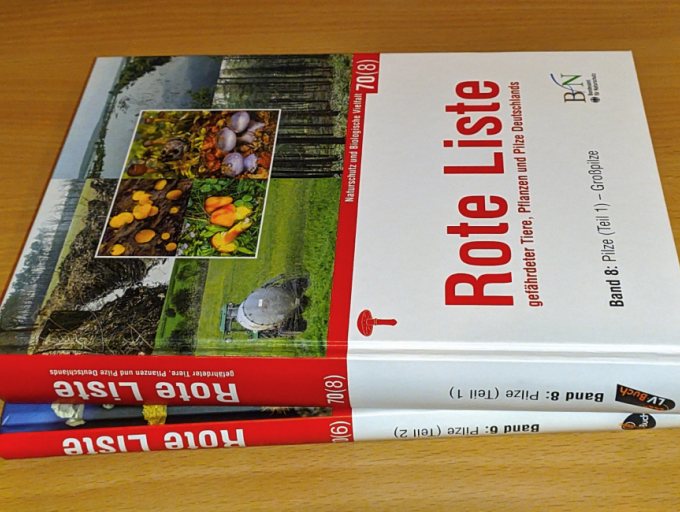
- Details
Bereits im Dezember 2019 hat das Rote-Liste-Zentrum (RLZ) in Bonn eine Artensuchmaschine in Betrieb genommen. Damit macht sie den Gefährdungsstatus von rund 30.000 untersuchten Tieren, Pflanzen und Pilzen Deutschlands kostenlos recherchierbar.
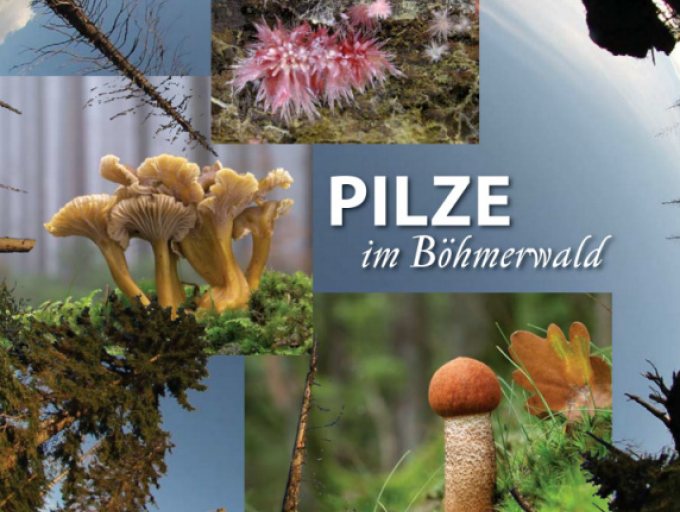
- Details
Der Nationalpark Šumava hat die Broschüre „Pilze im Böhmerwald“ in deutscher und tschechischer Sprache veröffentlicht. Sie umfasst eine Übersicht der häufigsten Gift- und Speisepilze, Kurzporträts von Naturnähezeigern sowie einige Raritäten aus dem Reich der Pilze.

- Details
In der TV-Doku „Die geheime Welt der Pflanzen“ von Erna Buffie haben ab 21:52 auch Pilze ihren Auftritt. Der Fokus liegt auf dem „Wood Wide Web“, wie das unterirdische Geflecht aus den Zellfäden von Mykorrhizapilzen und den Wurzeln von Waldbäumen zuweilen genannt wird. Demnach ist der Stand überholt, Pflanzen würden nur miteinander konkurrieren.

- Details
Die Bayerischen Staatsforsten haben bei Kist (Unterfranken) nördlich des Naturschutzgebiets „Blutsee-Moor“ ein kleines Pilzschutzgebiet ausgewiesen. Es soll von den Pilzfreunden Mainfranken ehrenamtlich betreut werden. Neben der Bestimmung und Kartierung der dortigen Pilzfunde sind auch Infoveranstaltungen für Bürger angedacht. Das Projekt ist zunächst auf 10 Jahre befristet mit Aussicht auf Verlängerung.

- Details
Seit April dieses Jahres hat das Pilzkundekabinett in Reinhardtsgrimma, etwa 20 km südlich der sächsischen Landeshauptstadt Dresden, wieder seine Pforten geöffnet. Dort können Pilzinteressierte bis November jeden Sonn- und Feiertag von 10 bis 17 Uhr die naturgetreuen Pilzmodelle von Reiner Hellwig bestaunen. Für Gruppen sind auch Führungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

- Details
Dr. Lothar und Katharina Krieglsteiner porträtieren in einem YouTube-Video den Sklerotienporling oder Kleinen Schuppenporling (Polyporus tuberaster) inklusive des zugehörigen „Pilzsteins“. Den Pilz kannten übrigens schon die alten Römer und zogen ihn im Haus oder Garten.

- Details
Cryptostroma corticale, der Erreger der Ahorn-Rußrindenkrankheit, rafft die im Rekordhitzejahr 2018 gestressten Ahorne dahin. Der DGfM-Toxikologe Prof. Dr. med. Siegmar Berndt klärt auf, inwieweit gesundheitliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind.
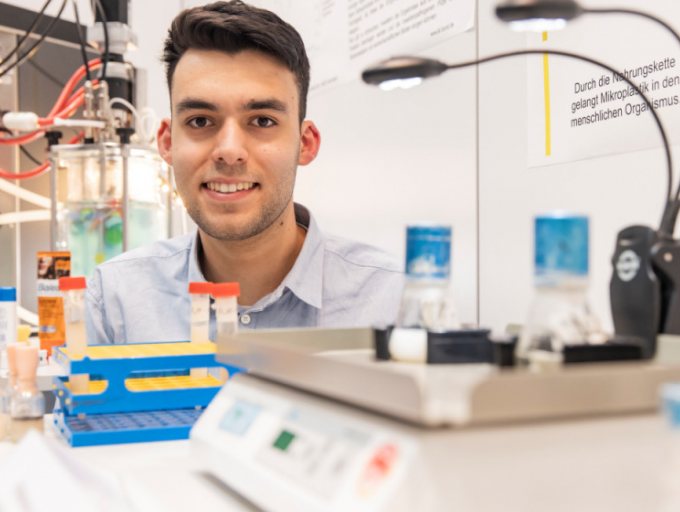
- Details
Pilze gegen Mikroplastik: Ein Schüler aus Offenbach nimmt mit seinem Jugend-forscht-Beitrag „Insektenpathogene Pilze und ihr Potenzial, Kunststoff biologisch abzubauen“ am Bundeswettbewerb teil. Der 17-jährige hat die Zukunftsvision, belastete Böden mit der Hilfe von Pilzen zu dekontaminieren.

- Details
Forscher von der kanadischen Universität Alberta fanden heraus, dass die meisten Wolfsflechten gleich drei Pilzarten beherbergen: den Hauptpilz, eine Hefe und einen Gallertpilz aus der Gattung Tremella.

- Details
Unter dem Motto „Spread the Spores“ wollen die Veranstalter/innen das Wissen und Bewusstsein rund um Pilze und ihre Anwendungsmöglichkeiten erweitern, um gemeinsam die Zukunft innovativer und nachhaltiger zu gestalten. Der Eintritt ist frei.

- Details
Die knolligen Fruchtkörper einiger Trüffelarten zählen zu den teuersten Lebensmitteln der Welt. Doch angebaute Périgord-Trüffeln aus Spanien könnten die Preise künftig deutlich senken.

- Details
Der Botanische Garten in Kew bei London (England) informiert Interessierte auf einer Website mit schönen Bildern und knappen Texten über den aktuellen Zustand der Pilze auf unserem Planeten. Inhaltlich ist stateoftheworldsfungi.org in 10 Rubriken gegliedert:

- Details
Im „Nature“ erschien vor einem halben Jahr die Studie eines internationalen Forscherteams, die auf die zu hohen Stickstoffeinträge und deren negative Folgen auf das Zusammenspiel von Mykorrhizapilzen und Waldbäumen hinweist. Jetzt griff das Thema ein deutsches Leitmedium auf.
Unterkategorien
© Deutsche Gesellschaft für Mykologie e.V. | Content Management by Joomla!